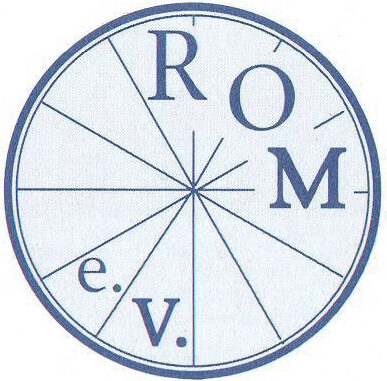Zur Beschäftigung mit dem Rassismus gegen Rom:nja und Sinti:ze gehört die sprachkritische Auseinandersetzung mit der rassistischen Fremdbezeichnung sowie Worten, die Machtasymmetrien reproduzieren. Die Frage muss häufig lauten: Wer spricht wie über wen?
Wir haben auf der Website versucht, solche Terminologien zu vermeiden. Wenn das nicht ging, wollen wir sie doch wenigsten kritisch reflektieren.
Deshalb entsteht hier ein kritischer Glossar. Dieser soll helfen, einige Worte besser einzuordnen.
Antiziganismus // Balkan // Ethnizität/Ethnische Herkunft // Orientalismus // Rassistische Fremdbezeichnung // Romantisierung // Samudaripe
Antiziganismus
Antiziganismus ist ein historisch hergestellter stabiler Komplex eines gesellschaftlich etablierten Rassismus gegenüber sozialen Gruppen, die mit dem Stigma Zigeuner (rassistische Fremdbezeichnung) oder anderen verwandten Bezeichnungen identifiziert werden. Er umfasst:
- eine homogenisierende und essentialisierende Wahrnehmung und Darstellung dieser Gruppen;
- die Zuschreibung spezifischer Eigenschaften an diese;
- vor diesem Hintergrund entstehende diskriminierende soziale Strukturen und gewalttätige Praxen, die herabsetzend und ausschließend wirken und strukturelle Ungleichheit reproduzieren.
Der Begriff ist zu Recht umstritten. Im Kern der Kritik steht dabei das Argument, dass der enthaltene Wortstamm eine stigmatisierende Fremdbezeichnung reproduziert und dadurch legitimiert. Markus End folgend liegt darin allerdings auch seine Stärke: „Die Benennung als ‚Antiziganismus‘ betont den Konstruktions-Charakter und umfasst alle Personen und Gruppen, die von antiziganistischer Ausgrenzung und Verfolgung betroffen waren und sind“ (End 2016: 57). Wir sind der genannten Definition, wegen der Zuschreibung des Konstruktionscharakters des Terminus gefolgt. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei der rassistischen Fremdzuschreibung um eine Konstruktion – um Klischees und Stereotypen – handelt, welche Menschen aus den Communities übergestülpt wird.
Vgl. Pickel, Susanne und Stark, Toralf (2022): Antiziganismus als eigenständige Form des Rassismus gegenüber Sinti*zze und Rom*nja. Ergebnisse einer Pilotstudie zur mehrdimensionalen Erfassung antiziganistischer Einstellungen in der Mehrheitsgesellschaft. In: Forschungsergebnisse aus Kurzstudien des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors (NaDiRa) #3/22, Berlin. Hier
Vgl. End, Markus(2016): Die Dialektik der Aufklärung als Antiziganismuskritik. Thesen zu einer Kritischen Theorie des Antiziganismus. In: Wolfram Stender (Hg.): Konstellationen des Antiziganismus. Theoretische Grundlagen, empirische Forschung und Vorschläge für die Praxis, Wiesbaden, S. 57–61.
Balkan
Balkanismus
Maria Todorova hat den Begriff des „Balkanismus“ in den 1990er-Jahren eingeführt. Sie vertritt die Meinung, dass Konzepte wie der Orientalismus von Edward Said auf einige Regionen nicht angewendet werden können.
Balkanismus ist keine Unterkategorie des Orientalismus, sondern eher eine Ergänzung. Während der Orient als das „vollständige Andere“ des europäischen Selbst konstruiert wird, ist der Balkan das „unvollständige Andere“. Sozusagen eine „unreine“ Form des „Anderen“, wodurch auch die Menschen dort gewissermaßen als „unrein“ stereotypisiert werden. Der Balkan wird als eine Übergangsregion zwischen Orient und Okzident betrachtet. Er wird bis heute stets mit Gewalt und Primitivität, mit Konservatismus und mit einer patriarchalen Gesellschaft in Verbindung gebracht.
Genauso wie DEN „Orient“ gibt es auch DEN „Balkan“ nicht wirklich: Es sind wirkmächtige westliche Sichtweisen (im Sinne der postkolonialen Theorie) auf außereuropäische Kulturen.
Berge
„Balkan“ ist die türkische Bezeichnung für Gebirge und zunächst neutral. Im ausgehenden 18. und besonders im 19. Jahrhundert beginnt jedoch eine sehr starke Semantisierung und negative Konnotation des Begriffs. Dem vorher neutralen Begriff, der eigentlich nur Berge bezeichnete, wurden in dieser Zeit weitere Bedeutungen zugeschrieben. Durch die Semantisierung wurde der Begriff auch abwertend umgedeutet.
Abwertung
Die Region, die heute als „Balkan“ bezeichnet wird, war rund 500 Jahre Teil des relativ konfliktarmen Osmanischen Reiches. Im 19. Jahrhundert wurden in der Region viele Stereotype des westlichen Denkens über den „Orient“ übernommen. Die Übernahme der Stereotype erfolgte dabei teilweise um die Erweiterung der Zuschreibung des „Unreinen“.
Islam-Abwertung
Die Ablehnung des islamischen Glaubens, die sowohl Teil des „Balkanismus“ als auch des „Orientalismus“ ist, wurde übernommen. So tauchen ab dem 19. Jahrhundert antimuslimischen Stereotype z.B. in der Kunst immer wieder auf. Sie setzten auf Binaritäten, auf das schwarz-weiß Bild von den guten Christen hier und den bösen Muslimen dort.
Vgl. Samuela Nickel im Interview mit Martina Baleva (2020): Das unvollständige Andere. Die Historikerin Martina Baleva über die Erfindung des Balkans in der Kunst des 19. Jahrhunderts, in: Neues Deutschland. Journalismus von links, 25.09.2020 hier.
Ethnizität / Ethnische Herkunft
Der Begriff Ethnizität stammt aus den Sozial- und Kulturwissenschaften. Der Begriff bezeichnet Fremdzuschreibungen gegenüber einem nicht genauer definierten „Anderem“. Seit den 1980er-Jahren ist das Konzept der Ethnizität im wissenschaftlichen Diskurs zunehmend umstritten, weil es eine definierbare Gemeinsamkeit annimmt: Ethnizität setzt die Vorstellung einer gemeinsamen, abschließend ausgehandelten, kollektiven Identität voraus. Erst das ermöglicht die abgrenzende Definition des Anderen. Anders gesagt: Der Begriff setzt voraus, dass Ethnizität auf einer vordiskursiven – das heißt in einer feststehenden, keinen Aushandlungsprozesse bedürfenden – Realität existiert.
Das würde auch bedeuten, dass die so benannte Gemeinschaft eine historische Kontinuität aufweist. Das ist eine Vorstellung, die sehr eng dem „Rassenkonzept“ angelehnt ist. Deshalb muss der Begriff abgelehnt werden. Der Konstruktivismus (eine Wissenschaftstradition) lehnt den Begriff Ethnizität ab und hinterfragt das Konzept der (kollektiven) Identität kritisch. Denn Identität, die entscheidende Größe für Ethnizität, kann nicht als gegeben angenommen werden. Identität ist für jeden Menschen anders: Sie wird subjektiv ausgehandelt und ist deswegen ein Prozess – denn jeder kann sich jeder Zeit verändern: Weltanschauungen bleiben niemals gleich.
Vgl. Sökefeld, Martin (2007): Problematische Begriffe: „Ethnizität“, „Rasse“, „Kultur“, „Minderheit“. In: Schmidt-Lauber, Brigitta (Hrsg.): Ethnizität und Migration. Einführung in Wissenschaft und Arbeitsfelder. Reimer Kulturwissenschaften, Berlin, S. 31-50. Hier
Orientalismus
Beschreibt ein eurozentristisches Konzept, welches auf Gesellschaften der arabischen Welt und des sog. „Nahen Ostens“ angewandt wird. Ziel des Konzepts ist es, die Gesellschaften als „anders“ zu konstruieren.
Machtposition
Dieses Konzept drückt ein Überlegenheitsgefühl gegenüber dem „Orient“ aus: Der „aufgeklärte Westen“ sei damit dem „mysteriösen Orient“ überlegen. Sehr kurz gesagt, geht es darum, eine wissenschaftlich-aufgeklärte Gesellschaft gegenüber einer angeblich mystischen und mit Magie in Verbindung stehenden Gesellschaft zu konstruieren.
Das Verhältnis: „Orient“ und „Okzident“
Edward Said, der den Begriff Orientalismus prägte, hat anhand akademischer Schriften, Reiseliteratur und Romanen herausgefunden, dass der „Orient“ eine Konstruktion – ein romantischer Sehnsuchtsort – ist. In diesem Fremdbild erschufen die in Europa lebenden Menschen einen exotischen Schauplatz für das „Andere“ und für ihr eigenes (nicht-rationales) Unterbewusstses. Die europäische Kultur wurde dabei als rational, friedliebend, logisch denkend usw. definiert. Der Orient hingegen wird als radikales Gegenbild dieses Entwurfs dargestellt: Irrational, kriegerisch, mystisch und magisch. Der „Orient“ ist weiblich, der „Okzident“ männlich konnotiert.
Religiöse Abwertung
In dem Konzept steckt aber noch viel mehr. Dem Orientalismus ist eine ungebrochene Traditionen der Feindseligkeit gegenüber dem islamischen Glauben inhärent. Vgl. hier zu „Balkanismus“
Postkoloniale Theorie
Das Konzept des Orientalismus ist umstritten. Trotzdem hat es viele Anschlusspunkte und bildet eine der wichtigsten Grundlagen für die postkoloniale Wissenschaft. Mit dem Konzept des Orientalismus kann untersucht werden, wie stark die europäische Sichtweise auf andere Regionen, z.B. dem „Balkan“, von kolonialistischen Annahmen geprägt ist.
Vgl. Wiedemann, Felix (2012): Orientalismus, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 19. 4.2012. Hier
Rassistische Fremdbezeichnung
Zigeuner ist eine rassistische Fremdbezeichnung, die unter anderem zur Bezeichnung der Communities der Rom:nja und Sinti:ze verwendet wird. Diese Fremdbezeichnung wird seit Jahrhunderten verwendet. Wie der Begriff entstanden ist, ist unklar: Was feststeht, ist, dass er in seiner Verwendung fast immer mit Ideen von Minderwertigkeit und Abwertung verbunden ist. Von den meisten Menschen in den Communities wird der Begriff deshalb abgelehnt. Ein anderer Grund für die Ablehnung ist die Geschichte: Die rassistische Fremdbezeichnung ist sehr eng mit der Verfolgung von Rom:nja und Sinti:ze im Nationalsozialismus verknüpft. Damals wurden Menschen aus den Communities mit einem „Z“ markiert. Hinter dem „Z“ stand eine Nummer. In den Konzentrationslagern ersetzte diese Kombination den Namen der Menschen – sie wurden also vor ihrer Ermordung ihres Namens beraubt.
Aber: Einige Menschen aus den Communties nutzen den Begriff für sich selbst. Sie wollen den Begriff damit für sich zurückgewinnen. Das ist auch okay – jede Person hat das Recht, sich selbst zu nennen, wie sie möchte. Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass jemand – vor allem, wenn die Person nicht aus den Communities ist – den Begriff ebenfalls verwenden darf.
Während des ersten internationalen Romani Kongress nahe London, beschlossen verschiedene Vertreter von Romani Selbstorganisationen die Ablehnung dieser Fremdbezeichnung. Das alles fand erst 1971 statt. Damals einigten sich die Communities auf die Nutzung des eigenen Begriffes Roma. Roma ist also eine Selbstbezeichnung. Wir streichen den Begriff, wenn wir ihn verwenden müssen, durch. Wir folgen damit einer Idee von Menschen aus den Communities. Sie sagen: Wenn es unbedingt sein muss, dann kann man den Begriff aktiv nicht schreiben: Ihn durchstreichen. Damit stören wir den Begriff und tragen dazu bei, dass er nicht mehr aktiv genutzt wird.
Vgl.Barz, Hajdi (2019): MIMANS GESCHICHTE. Handreichung zum Thema Gadjé-Rassismus. Pädagogisches Begleitmaterial zu vier Video-Modulen aus dem Dokumentarfilm, Berlin, S. 99. Hier
Romantisierung
Neben den vielen negativen Stereotypen und Abwertungen existieren im Dominanzgesellschaftlichen Diskurs auch vermeintlich positive Fremdzuschreibungen und Narrative über Rom:nja und Sinti:ze. Auch diese sind nicht weniger rassistisch, falsch und gefährlich. Wie die negativen Fremdzuschreibungen haben sie wenig bis nichts mit der imaginierten Gruppe zu tun, aber viel mit den Projektionen der Mehrheitsgesellschaft.
„Nahe Fremde“
Während die „edlen Wilden“ in der Vorstellungswelt des aufklärerischen Europas als von der Zivilisation unverdorbene „Naturmenschen“ in Ozeanien und den Amerikas lebten, dienten Rom:nja und Sinti:ze unter dem Phantasma der rassistischen Fremdbezeichnung als innereuropäisches Äquivalent und „nahe Fremde“. In ihnen hatte die europäische Moderne ihre Antithese erdacht. So figurierte das von der Mehrheitskultur unter der rassistischen Fremdbezeichnung konstruierte Kollektiv als Gegenbild sesshafter und bürgerlicher Lebensweisen. Dass etwa die vermeintliche Wanderung von tatsächlichen Rom:nja und Sinti:ze vor allem auch das Ergebnis von Vertreibungen waren und nicht eines ungestümen Freiheitsdrangs, störte die Imagination nicht.
Beispiel Musikalität
Für einige Künstler erschien dieses Leben in Sorglosigkeit und Ungebundenheit attraktiv und wurde etwa unter dem Begriff der „Bohème“ idealisiert. Jedoch bestätigt auch diese Form der Darstellung, die Andersartigkeit und die Zuschreibung von Eigenschaften, die zwar individuell geschätzt, dominanzgesellschaftlich jedoch verachtet werden. Auch das Stereotyp der Musikalität, die Rom:nja und Sinti:ze vermeintlich angeboren sei, hat ihre negative Kehrseite. Nicht im Lernen, Üben und Verstehen von Musik und Instrument ist sie begründet, sondern Rom:nja und Sinti:ze seien Naturtalente. Eine künstlerische Leistung oder gar ein Beitrag zur eigenen Kultur wird nicht anerkannt.
Philoziganismus und Antiziganismus
Auch die wohlmeinende Idealisierung der vermeintlich freien, ursprünglichen und ungebundenen, ortlosen Lebensweise ist Teil einer diskursiven Alterisierung, die das Fremdbild, vor allem aber Selbstbild der Dominanzgesellschaft bestätigt. Der Philoziganismus ist damit lediglich die Kehrseite des Antiziganismus. Gemeinsam ist ihnen die diskursive Konstruktion des Anderen. Die Folgen dieser Fremdzuschreibungen erfuhren Rom:nja und Sinti:ze als sie auf Grundlage dieser ihnen zugeschriebenen Eigenschaften gesellschaftlich ausgrenzt und verfolgt wurden. Sinnbildlich für den Zusammenhang von diskursiver Alterisierung und brutaler Gewalt ist die Tätowierung des Z in die Haut verschleppter Sinti:ze und Rom:nja in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern.
Die marginalisierte Lebensweise, in die Rom:nja und Sinti:ze gedrängt wurden und werden, sollte nicht romantisiert werden.
Vgl. Bogdal, Klaus Michael (2011): Europa erfindet die Zigeuner. Eine Geschichte von Faszination und Verachtung, Bonn;
Brittnacher, Hans Richard (2012): Leben auf der Grenze. Klischee und Faszination des Zigeunerbildes in Literatur und Kunst. Nürnberg;
Engbring-Romang, Udo (2017): Der Weg der Sinti und Roma. Wie „Zigeuner“-Bilder und Vorurteile einen Völkermord möglich machen konnten. Texte und Materialien zur Ausstellung, Marburg.
Samudaripe
Wenngleich in der Bundesrepublik lange geleugnet und relativiert, stellte die nationalsozialistische Verfolgung der Rom:nja und Sinti:ze einen Völkermord dar. Sie wurden erfolgt, entrechtet, deportiert und getötet, weil sie Rom:nja und Sinti:ze waren und unter der rassistischen Fremdbezeichnung ebenso wie Juden als Feinde definiert wurden. Wenn auch nach 1945 häufig bestimmte, weiterhin stigmatisierte tatsächliche oder nur zugeschriebene Verhaltensweisen als Begründung für die Verfolgung vorgeschoben wurden, wurden sie – wie spätestens der Auschwitz-Befehl Heinrich Himmlers vom 16. Dezember 1942 belegt – allein wegen ihrer Angehörigkeit zu der Minderheit der Rom:nja und Sinti:ze verfolgt. Dieser Fakt ist nicht zu leugnen. Zur Bezeichnung dieses Völkermordes wurden jedoch unterschiedliche Begriffe genutzt.
Begriffspolitik
Weil der Völkermord in der Bundesrepublik über lange Zeit nicht anerkannt wurde, war es die Bürger:innenrechtsbewegung der Rom:nja und Sinti:ze, welche die bundesrepublikanische Politik und Gesellschaft dazu drängten, die an ihnen und ihren Vorfahren begangenen Verbrechen einzugestehen, wie es bereits bei Jüdinnen und Juden schrittweise passiert war. Um die gleiche Anerkennung einzufordern, wurde damals der Begriff Holocaust (aus dem altgriechischen = „vollständig verbrannt“) auf die Verbrechen an den Rom:nja und Sinti:ze angewandt. Dies führte zum Vorwurf der Relativierung der Einmaligkeit des Holocausts. In der Zwischenzeit hat die neuere Forschung jedoch herausgearbeitet, dass die genozidale Intention und die eliminatorische Praxis der Verfolgung von Jüdinnen und Juden und Rom:nja und Sinti:ze die gleiche war.
Roma-Holocaust
Der Begriff Holocaust wurde in diesem Sinne nicht mehr als exklusive Bezeichnung der Verfolgung von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus verwandt, sondern als ein Begriff, der die genozidale Praxis des nationalsozialistischen Regimes in Bezug auf verschiedene Opfergruppen bezeichnet. Der Begriff ist jedoch selbst nicht unumstritten, da er in der Antike das Brandopfer von Tieren meinte.
„Porajmos“
Der Roma-Aktivist Ian Hancock etablierte dagegen den Begriff „Porajmos“ – eine Wortneuschöpfung, die als „Verschlingen“ oder als „Zerstörung“ übersetzt werden kann. Allerdings wies der Linguist Marcel Courthiade darauf hin, dass das zugrundeliegende Verb porravel, das in Romanes das Öffnen des Mundes meint, in der Umgangssprache mancher Roma-Dialekte auch sexuelle Konnotationen habe und deshalb unpassend sei. Eine Einschätzung, der wir uns anschließen.
Samudaripe
Stattdessen plädieren wir ebenso wie Courthiade für die Bezeichnung Samudaripe. Es ist ein Neologismus aus dem Romanes und setzt sich zusammen aus sa (Alle) und mudaripe (Mord) und meint damit die vollständige Ermordung. Der Begriff wurde in den 1970er Jahren im Kontext der Aufarbeitung der Verbrechen in den Lagern Auschwitz und Jasenovac erstmals verwandt. Der Rom e. V. wie auch die International Romani Union verwenden mittlerweile diesen Begriff. Auch weil er, wie Courthiade argumentiert, unmissverständlich, neutral und respektvoll ist. Im Gegensatz zu „Porajmos“ ist er unpathetisch und benennt präzise die genozidale Intention der nationalsozialistischen Verfolgung von Rom:nja und Sinti:ze.
Vgl. Hancock, Ian (2006): „On the interpretation of a word: Porrajmos as Holocaust“. The Romani Archives and Documentation Center – RADOC. Karola Fings: Völkermord, Holocaust, Porajmos, Samudaripen. https://www.romarchive.eu/de/voices-of-the-victims/genocide-holocaust-porajmos-samudaripen/.
weitere Begriffe die demnächst hier hinzugefügt werden: